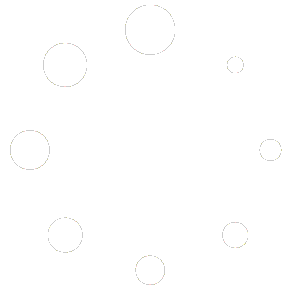Ende gut, alles gut?
von Alexander Poraj, Zen-Meister und Mitglied der spirituellen Leitung am Benediktushof
Nach langer Pause höre ich diesen Satz in der letzten Zeit immer öfter. Viele von uns können ihn, bezogen auf die Entwicklung der Pandemie und der Nachwirkungen des Lockdowns, so sagen. Manche von uns können das nicht oder noch nicht. Einige gar nicht mehr. Der Satz stimmt also nur bedingt, was jedoch seinen Wahrheitsgehalt nicht schmälert. Interessanterweise drückt er eine Tatsache aus, die wir des Öfteren übersehen. Er besagt, dass die letzten Ereignisse und genauer genommen unsere Gefühle und Emotionen, welche diese Ereignisse begleiten, darüber entscheiden, wie wir dieses Ereignis bewerten und mit welcher Qualität es in unserer Erinnerung aufbewahrt wird.

Nehmen wir an, Sie fahren nach einem schönen Ausflugswochenende nach Hause und erleben einen Stau nach dem anderen, so dass sich die Heimfahrt um gut zwei Stunden verlängert. Und da ihre Klimaanlage auch noch den Geist aufgegeben hat, schmoren Sie in gereizter Begleitung Ihrer Familie dahin.
„Das machen wir nie wieder!“ hören Sie sich selber sagen und „Wir wollten eh zu Hause bleiben!“ kommentieren die Kids. Und das, obwohl sie sich zwei Tage lang köstlich amüsiert hatten. Fazit: Zwei Stunden schlechte Laune machen 48 Stunden Zufriedenheit zunichte. Ende schlecht, alles schlecht. So sieht nämlich der Gegensatz zu unserer Überschrift jetzt aus.
Noch deutlicher wird es sichtbar und vor allem fühlbar bei Trennungen aller Art. Es ist schon ein Phänomen, dass wir in der Verletzbarkeit und Gereiztheit des Trennungs- und Scheidungsprozesses gut und gerne Jahre und Jahrzehnte des durchaus konstruktiven Zusammenlebens ausblenden können und häufig am liebsten ALLES vergessen möchten.
Daher sollte es uns schon ein wenig nachdenklich stimmen, wie es dazu kommt, dass ein paar Emotionen in der Lage sind, Jahrzehnte unseres Lebens mit all seinen Varianten und Feinheiten im Nu zu umfassen und zu vernichten.
Vieles spricht dafür, dass es an der Stärke der jeweiligen Emotion liegt. Je stärker sie ist, umso umfangreicher muss die jeweilige Narration sein, die sie „erklären“ soll. Ist meine Enttäuschung also riesig groß und die sie begleitende Wut und Trauer ebenfalls, so hat mein Leben kaum noch „Sinn“. Ist doch logisch, oder? Auf jeden Fall glaube ich in diesem Moment, dass es nicht nur so ist, sondern dass jeder dem ich es erzähle, es genauso sehen muss. Alternativen können einfach nicht geduldet werden. Warum eigentlich?
Und was hat das mit unserer Zazen- oder kontemplativen Übung zu tun? Nun, das Sitzen macht unter anderem deutlich, dass nicht „wir“ je nach Gefühl oder Emotion unbedingt etwas tun oder denken müssen, sondern dass das Bewusstsein der „Raum“ ist, als welcher sich alles zeigt und auch wieder vergeht. Das gilt vor allem dann, wenn dieser Bewusstseinszustand nicht durch eine entsprechende Geschichte künstlich am Leben gehalten wird.
Mit anderen Worten:
Alexander Poraj
„Emotionen sind genauso flüchtig, wie Gedanken und beide hängen – nicht immer, aber doch sehr häufig – am Tropf ihrer passenden Narration.“
Je nach emotionalem Zustand, malen wir uns sofort die Welt in schönsten Farben oder in Grautönen aus, wodurch die jeweilige Emotion verstärkt wird. Obendrauf sind wir auch noch fest davon überzeugt, Dank der gerade erfundenen Narration ihre wahre Daseinsberechtigung gefunden zu haben.
Was also tun? Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Weinen, wenn es uns danach zu Mute ist oder Lachen, wenn die Umstände das Zwerchfell kitzeln. Wir können uns ein wenig darin üben, das Gefühl oder die Emotion einzig und allein auf die jetzt stattfindende Situation zu beziehen, anstatt sie narrativ zu verallgemeinern. Das reicht vollkommen und wird beidem, der Situation und dem Gefühl, eher gerecht, als wenn wir aus der Situation in eine aufgeblasene Narration flüchten, die meistens alles verzehrt. Nicht nur das Unangenehme wird so kultiviert. Auch das Schöne wird durch unsere Geschichten verklärt.
„Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.“
Andreas Möller
Belassen wir es doch bei dem gewöhnlichen Sosein. Dieses Sosein nämlich, unmittelbar empfunden, ist in der Regel reichhaltiger an Gefühlsschattierungen als die durch Narration verstärkte Emotion.
Und noch etwas: Lassen wir das Leben die Interpunktion selbst machen. Denn da, wo wir das „Ende“ sehen und einen Punkt setzen wollen, sieht das Leben häufig einen Doppelpunkt. Wollen wir unbedingt ein Ausrufezeichen haben, setzt das Leben drei Pünktchen. Ist uns etwas unheimlich wichtig, setzt das Leben es komischerweise in Klammern oder in die Fußnote. Und das, was wir gerne vergessen würden, wird vom Leben in Fett- und in Großbuchstaben gedruckt.
Wir wissen es nicht wirklich. Und auch unsere Gefühle irren sich häufig. Und trotzdem wird es am Ende gut und zwar aus dem einfachen Grund, weil es schon am Anfang gut war.